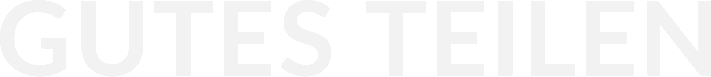Immer mehr Kommunen setzen auf essbare Begrünungskonzepte wie Urban Gardening, Tiny Forests oder Stadtobst. Dabei geht es nicht nur um ökologische Aspekte, sondern auch um Teilhabe, Biodiversität und Bildung. Ein frühes Beispiel ist die Stadt Andernach, die bereits seit den 2010er-Jahren öffentlich zugängliches Obst und Gemüse anbietet – unter dem Motto „Essbare Stadt“.
Auch in Wuppertal und anderen Städten entstehen vermehrt Streuobstwiesen mit alten Obstsorten, die frei beerntet werden dürfen. Die Finanzierung erfolgt teils über Bürgerbudgets, die Pflanzung und Pflege übernehmen oft ehrenamtliche Initiativen.
Dabei knüpft das Konzept an historische Wurzeln an: Schon im 19. Jahrhundert wurden in städtischen Grünanlagen Obstgärten für Arbeiterfamilien eingerichtet. Die Früchte wurden öffentlich versteigert, die Pflege durch sogenannte Wartkräfte organisiert.
Heute liegt der Fokus stärker auf Bildung und Eigenverantwortung. In Wuppertal beispielsweise kümmert sich ein ehrenamtliches Team um den Obstbaumschnitt und führt Workshops an Schulen durch. Ein digitales Informationssystem mit QR-Codes an Bäumen soll künftig über Sorten und Erntezeiten aufklären, um zu frühes Pflücken zu vermeiden.
Auch gesundheitlich ist Stadtobst unbedenklich. Studien zeigen, dass selbst auf belasteten Böden kaum Schadstoffe in die Früchte gelangen. Luftverschmutzung spielt bei Baumobst eine geringere Rolle als bei niedrig wachsenden Pflanzen – im Gegensatz zu intensiv behandelten Früchten aus dem Supermarkt.
Wo die Voraussetzungen stimmen, kann Stadtobst einen wertvollen Beitrag zur urbanen Ernährung und Lebensqualität leisten.
Bild Ⓒ Pexels.com
https://www.tagesschau.de/wissen/klima/obstanbau-in-staedten-100.html